Ausführlicher Leitfaden zu Bootskennzeichen in Deutschland
Die Kennzeichnungspflicht für Kleinfahrzeuge auf deutschen Binnengewässern: Ihr umfassender Ratgeber
📌 Hinweis zur rechtlichen Verbindlichkeit
Dieser Beitrag wurde mit größter Sorgfalt erstellt und basiert auf dem Stand der Vorschriften vom 20. Mai 2025. Dennoch handelt es sich nicht um eine rechtsverbindliche Auskunft, sondern um eine sachlich aufbereitete Information für Bootsführer:innen und Interessierte. Rechtsvorschriften können sich ändern oder regional unterschiedlich ausgelegt werden. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie ausschließlich bei den zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern (WSA) oder anerkannten Verbänden wie ADAC, DMYV oder DSV.
Inhaltsverzeichnis
- I. Grundlagen: Was Sie über die Kennzeichnungspflicht wissen müssen
- II. Ausnahmen von der Regel
- III. Sonderfall Wassermotorräder (Jetskis)
- IV. Spezifische Regelungen auf Rhein, Mosel und Donau
- V. Auf anderen Bundeswasserstraßen
- VI. Amtlich anerkannte Kennzeichen (IBS & Alternativen)
- VII. Der Weg zum Kennzeichen
- VIII. Kleine Boote, eigene Regeln: Beiboote
- IX. Zusammenfassung und Checkliste
- X. Wichtiger Hinweis und Haftungsausschluss
- XI. Weiterführende Informationen und Links
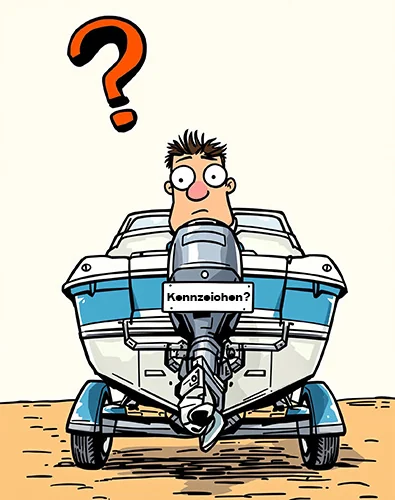
I. Grundlagen: Was Sie über die Kennzeichnungspflicht wissen müssen
Bevor spezifische Regelungen und Ausnahmen betrachtet werden, ist es wichtig, die grundlegenden Begriffe und Vorschriften zu verstehen, die die Basis der Kennzeichnungspflicht in Deutschland bilden.
A. Definition: Was ist ein „Kleinfahrzeug“?
Der Begriff „Kleinfahrzeug“ ist zentral für das Verständnis der Kennzeichnungsvorschriften. Gemäß der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO) ist ein Kleinfahrzeug ein Fahrzeug, dessen Schiffskörper ohne Ruder und Bugspriet eine größte Länge von weniger als 20 Metern aufweist. Diese Definition ist maßgeblich, da sie den Anwendungsbereich vieler Verordnungen und Regeln bestimmt. Es ist anzumerken, dass andere Regelwerke, wie die Schiffssicherheitsverordnung, abweichende Definitionen für spezifische Kontexte (z.B. Frachtschiffe) enthalten können, diese sind jedoch für die hier behandelte Kennzeichnung von Sport- und Freizeitbooten in der Regel nicht relevant.
B. Die Basis: Die Kleinfahrzeug-Kennzeichnungsverordnung (KlFzKV-BinSch)
Die primäre Rechtsgrundlage für die Kennzeichnung von Kleinfahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen ist die „Verordnung über die Kennzeichnung von auf Binnenschifffahrtsstraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen“, kurz KlFzKV-BinSch. Diese Verordnung legt fest, dass deutsche Kleinfahrzeuge grundsätzlich ein gültiges amtliches oder amtlich anerkanntes Kennzeichen führen müssen, um auf diesen Gewässern betrieben werden zu dürfen. Die KlFzKV-BinSch bildet somit die grundlegende Regulierungsebene. Andere Verordnungen, wie beispielsweise die spezifischen Polizeiverordnungen für einzelne Flüsse, bauen auf dieser Grundlage auf oder schaffen spezifische Ausnahmen und Ergänzungen. Dies zeigt ein gestuftes Regulierungssystem, bei dem die KlFzKV-BinSch die allgemeinen Anforderungen definiert, die dann für bestimmte Gewässer oder Situationen präzisiert werden.
C. Amtliche vs. amtlich anerkannte Kennzeichen: Eine wichtige Unterscheidung
Die KlFzKV-BinSch unterscheidet zwei Hauptkategorien von Kennzeichen:
- Amtliche Kennzeichen: Diese werden von den Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern (WSA) ausgestellt. Sie bestehen typischerweise aus einer Buchstabenkombination, die das ausstellende WSA identifiziert, gefolgt von einer weiteren Buchstaben- und/oder Ziffernfolge.
- Amtlich anerkannte Kennzeichen: Zu dieser Kategorie gehören:
- Kennzeichen, die aus der Nummer eines Internationalen Bootsscheins (IBS) bestehen. Diese werden von dazu ermächtigten Organisationen wie dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC), dem Deutschen Motoryachtverband (DMYV) oder dem Deutschen Segler-Verband (DSV) vergeben. Dem Kennzeichen wird ein Buchstabe vorangestellt, der die ausstellende Organisation kennzeichnet (z.B. A- für ADAC, M- für DMYV, S- für DSV).
- Kennzeichen, die von bestimmten Landkreisen ausgestellt werden. Eine Liste dieser Landkreise und ihrer Kennzeichenformate wird vom Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS) bereitgestellt.
Dieses duale System von amtlichen und amtlich anerkannten Kennzeichen bietet auf den meisten Wasserstraßen eine gewisse Flexibilität für Bootseigner. Es ermöglicht eine dezentrale Registrierung, indem anerkannte Verbände und lokale Behörden ebenfalls Kennzeichen vergeben dürfen, was den administrativen Aufwand für viele Bootsfahrer erleichtern kann. Diese Flexibilität erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit bei der Befahrung von Gewässern mit strengeren Regelungen, wie Rhein, Mosel und Donau, wo diese Wahlfreiheit eingeschränkt ist.
Beispiele unserer Bootsaufkleber:
D. Vorgaben für das Kennzeichen: Größe, Farbe und Anbringungsort
Unabhängig davon, ob es sich um ein amtliches oder amtlich anerkanntes Kennzeichen handelt, gibt es allgemeine Anforderungen an dessen Ausgestaltung und Anbringung:
- Größe und Schrift: Das Kennzeichen muss in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern ausgeführt sein.
- Beständigkeit: Es muss dauerhaft und fest am Fahrzeug angebracht sein.
- Farbkontrast: Die Schrift muss entweder in heller Farbe auf dunklem Grund oder in dunkler Farbe auf hellem Grund gestaltet sein, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten.
- Anbringungsort: Allgemein ist das Kennzeichen außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anzubringen. Wie in Abschnitt V erläutert wird, gibt es für bestimmte Wasserstraßen (z.B. Rhein und Mosel) präzisere Vorgaben, die eine Anbringung am Bug vorschreiben.
- Lesbarkeit: Der Schiffsführer ist dafür verantwortlich, dass das Kennzeichen jederzeit deutlich sichtbar und lesbar ist.
II. Ausnahmen von der Regel: Wann ist mein Boot von der Kennzeichnungspflicht befreit?
Die KlFzKV-BinSch sieht eine Reihe von Ausnahmen vor, bei denen Kleinfahrzeuge von der Pflicht zur Führung eines amtlichen oder amtlich anerkannten Kennzeichens befreit sind. Es ist jedoch entscheidend zu verstehen, dass eine Befreiung von der Kennzeichnungspflicht nach KlFzKV-BinSch nicht zwangsläufig bedeutet, dass gar keine Kennzeichnung erforderlich ist. Gemäß § 2.02 der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO) oder den spezifischen Polizeiverordnungen für einzelne Flüsse müssen auch solche ausgenommenen Fahrzeuge unter Umständen eine andere Form der Identifikation (wie Name des Bootes und Eignerdaten) tragen, falls sie kein amtliches oder amtlich anerkanntes Kennzeichen führen. Dies stellt eine Art sekundäres Identifikationssystem sicher.
Die Standardausnahmen von der Kennzeichnungspflicht nach KlFzKV-BinSch sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Tabelle 1: Überblick der Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht nach KlFzKV-BinSch
| Kategorie des ausgenommenen Fahrzeugs | Beschreibung |
|---|---|
| Nicht als Kleinfahrzeuge geltende Wasserfahrzeuge | Wasserfahrzeuge, die nach den Bestimmungen der BinSchStrO nicht als Kleinfahrzeuge gelten (z.B. Fahrgastschiffe für mehr als 12 Personen, Fähren, bestimmte Schlepp- oder Schubboote, schwimmende Geräte). |
| Muskelkraftbetriebene Fahrzeuge | Wasserfahrzeuge, die ausschließlich mit Muskelkraft fortbewegt werden können (z.B. Ruderboote, Kanus, Kajaks). Beiboote fallen ebenfalls oft hierunter, haben aber auch spezifische Regelungen (siehe Abschnitt IX). |
| Kleine Segelboote | Wasserfahrzeuge bis zu einer Länge von 5,50 Metern, die ausschließlich unter Segel fortbewegt werden können und keinen Motor besitzen. |
| Motorboote mit geringer Leistung | Wasserfahrzeuge mit einer Antriebsmaschine, deren effektive Nutzleistung nicht mehr als 2,21 kW (entspricht 3 PS) beträgt. |
| Beiboote | Werden auch separat als Ausnahme geführt (siehe auch Abschnitt IX). |
| Spezifische Fahrgastboote und Barkassen | Fahrgastboote im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 11 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung und Barkassen im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 12 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung. |
| Behörden- und Rettungsfahrzeuge | Fahrzeuge von Behörden (z.B. Wasserschutzpolizei, Zoll) und der Wasserrettung (z.B. DLRG, Wasserwacht), die eine dienstliche Kennzeichnung tragen. |
Beispiele unserer Bootsaufkleber:
III. Sonderfall Wassermotorräder (Jetskis): Strenge Vorgaben für den Fahrspaß
Für Wassermotorräder, umgangssprachlich oft als Jetskis bezeichnet, gelten besonders strikte Regeln. Im Gegensatz zu anderen Kleinfahrzeugen, bei denen Eigner oft die Wahl zwischen einem amtlichen und einem amtlich anerkannten Kennzeichen haben, müssen Wassermotorräder zwingend ein amtliches Kennzeichen führen, das von einem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) ausgestellt wurde. Amtlich anerkannte Kennzeichen, wie beispielsweise der Internationale Bootsschein (IBS) von Automobilclubs oder Wassersportverbänden, sind für Wassermotorräder nicht zulässig.
Diese strengere Handhabung für Wassermotorräder ist vermutlich auf deren spezifische Eigenschaften wie hohe Geschwindigkeit, große Wendigkeit und ein potenziell höheres Risikoprofil zurückzuführen. Die Notwendigkeit einer direkten und eindeutigen Registrierung bei einer staatlichen Behörde (WSA) dient dazu, eine bessere Nachverfolgbarkeit und effektivere Kontrollmöglichkeiten zu gewährleisten.
IV. Spezifische Regelungen auf Rhein, Mosel und Donau: Hier gelten besondere Gesetze
Auf den drei großen deutschen Bundeswasserstraßen Rhein, Mosel und Donau weichen die Vorschriften zur Kennzeichnung von Kleinfahrzeugen signifikant von den allgemeinen Regelungen ab. Diese Abweichungen sind für jeden Skipper, der diese Gewässer befahren möchte, von höchster Bedeutung.
A. Das Wichtigste vorab: Nur amtliche Kennzeichen erlaubt!
Die einschneidendste und wichtigste Regel für in Deutschland registrierte Kleinfahrzeuge auf Rhein, Mosel und dem deutschen Abschnitt der Donau lautet: Sie müssen ein amtliches Kennzeichen führen, das von einem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) ausgestellt wurde. Amtlich anerkannte Kennzeichen, wie der Internationale Bootsschein (IBS) von ADAC, DMYV, DSV oder Kennzeichen von Landkreisen, sind auf diesen drei Flüssen als primäres Kennzeichen nicht ausreichend und somit nicht zulässig.9
Diese strikte Vorgabe ist eine der häufigsten Fehlerquellen für Bootsfahrer und kann bei Kontrollen zu Problemen führen. Die Gründe für diese verschärften Anforderungen liegen in der besonderen Natur dieser Wasserstraßen: Sie weisen oft ein hohes Verkehrsaufkommen auf, haben einen ausgeprägt internationalen Charakter (insbesondere Rhein und Donau sind wichtige europäische Handelsrouten) und unterliegen spezifischen Sicherheits- und Navigationsprotokollen, die eine direkte staatliche Registrierung erfordern. Internationale Kommissionen wie die Rhein-, Mosel- und Donaukommission erlassen eigene Regelwerke, und die Pflicht zum Führen eines amtlichen Kennzeichens gewährleistet eine einheitliche und von den nationalen Behörden direkt verwaltete Registrierung, was die grenzüberschreitende Überwachung und Identifizierung vereinfacht.
B. Details zur RheinSchPV, MoselSchPV und DonauSchPV (§ 2.02)
Die genauen Bestimmungen finden sich jeweils im § 2.02 der schifffahrtspolizeilichen Verordnungen dieser Flüsse:
- Rhein:
- Die Kennzeichnung richtet sich nach § 2.02 der Rheinschiffahrtspolizeiverordnung (RheinSchPV).9
- Vorgeschrieben ist ein amtliches Kennzeichen.
- Dieses muss mindestens 10 cm hoch sein, in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund ausgeführt und an beiden Vorderseiten (Bugteilen) des Kleinfahrzeugs angebracht sein.9
- Mosel:
- Hier gilt § 2.02 der Moselschiffahrtspolizeiverordnung (MoselSchPV).10
- Vorgeschrieben ist ein amtliches Kennzeichen.
- Die Anforderungen an Größe, Farbkontrast und Anbringungsort (an beiden Vorderseiten (Bugteilen)) sind identisch mit denen auf dem Rhein.10
- Donau (deutscher Abschnitt):
- Die Regelungen finden sich in Anlage A § 2.02 der Donauschiffahrtspolizeiverordnung (DonauSchPV).12
- Vorgeschrieben ist ein amtliches Kennzeichen.
- Das Kennzeichen muss mindestens 10 cm hoch sein und außen am Fahrzeug angebracht werden. Obwohl der Text nicht explizit zwischen Bug und Heck unterscheidet, wird in der Praxis, analog zu Rhein und Mosel, eine Anbringung am Bug erwartet [User’s research]. Die Pflicht zum Mitführen des Ausweises über das amtliche Kennzeichen an Bord von Kleinfahrzeugen auf der Donau unterstreicht diese Anforderung.13
C. Ersatzkennzeichnung: Wenn Ihr ausgenommenes Boot dennoch markiert werden muss
Für den seltenen Fall, dass ein Kleinfahrzeug auf Rhein, Mosel oder Donau durch eine besondere Erlaubnis der zuständigen Behörde von der Pflicht zum Führen eines amtlichen Kennzeichens befreit wird (gemäß § 2.02 Nr. 2 der RheinSchPV und MoselSchPV, und analog vermutlich auch der DonauSchPV), greift eine Regelung zur Ersatzkennzeichnung. Diese ist nicht mit den allgemeinen Kennzeichnungsregeln für nach KlFzKV-BinSch ausgenommene Fahrzeuge auf anderen Wasserstraßen zu verwechseln. Es handelt sich um eine spezifische Ausweichregelung für diese streng regulierten Flüsse, die eine formelle Ausnahmegenehmigung voraussetzt.
In einem solchen Fall muss das Kleinfahrzeug folgende Kennzeichnungen tragen:
- Seinen Namen oder seine Devise: Dieser muss außen am Kleinfahrzeug an gut sichtbarer Stelle in gut lesbaren, mindestens 10 cm hohen lateinischen Schriftzeichen angebracht werden. Die Schrift muss in heller Farbe auf dunklem Grund oder in dunkler Farbe auf hellem Grund ausgeführt sein. Falls kein Name vorhanden ist, ist der Name der Organisation, der das Fahrzeug angehört, oder deren gebräuchliche Abkürzung, gegebenenfalls mit einer Nummer, anzugeben.
- Name und Anschrift des Eigentümers: Diese Angaben sind an einer gut sichtbaren Stelle an der Innen- oder Außenseite des Kleinfahrzeugs dauerhaft anzubringen.
Beispiele unserer Bootsaufkleber:
V. Auf anderen Bundeswasserstraßen (Elbe, Weser, Kanäle etc.): Die allgemeinen Regeln
Für alle anderen Bundeswasserstraßen, die nicht explizit Rhein, Mosel oder Donau heißen – also beispielsweise Elbe, Weser, Spree, Havel, die zahlreichen Kanäle wie der Main-Donau-Kanal oder der Mittellandkanal – gelten die allgemeinen Bestimmungen der Kleinfahrzeug-Kennzeichnungsverordnung (KlFzKV-BinSch) und der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO).
Dies bedeutet im Detail:
- Hier ist entweder ein amtliches Kennzeichen (ausgestellt von einem WSA) ODER ein amtlich anerkanntes Kennzeichen (z.B. ein IBS von ADAC, DMYV, DSV oder ein Kennzeichen eines berechtigten Landkreises) zulässig. Für die Mehrheit der Freizeitkapitäne auf diesen typischen deutschen Binnengewässern stellt somit ein IBS eine gängige und völlig vorschriftsmäßige Methode dar, die Kennzeichnungspflicht zu erfüllen. Dies vereinfacht das Verfahren im Vergleich zur Notwendigkeit, stets ein WSA aufsuchen zu müssen, wie es auf Rhein, Mosel und Donau der Fall ist.
- Die Anbringung des Kennzeichens erfolgt gemäß den Vorgaben der KlFzKV-BinSch: mindestens 10 cm hohe Buchstaben und Ziffern, dauerhaft, in heller Farbe auf dunklem Grund oder umgekehrt, außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck.
- Ist ein Fahrzeug gemäß den in Abschnitt II genannten Kriterien von der Kennzeichnungspflicht nach KlFzKV-BinSch ausgenommen (z.B. Motorleistung unter 2,21 kW, reiner Segelbetrieb unter 5,50 m Länge), muss es dennoch – sofern es sich nicht um ein Segelsurfbrett oder ein vergleichbares Kleinstfahrzeug handelt – gemäß § 2.02 BinSchStrO gekennzeichnet sein. Diese Ersatzkennzeichnung umfasst:
- Den Namen oder die Devise des Fahrzeugs: außen, gut sichtbar, mindestens 10 cm hohe lateinische Schriftzeichen, heller Grund/dunkle Schrift oder umgekehrt. Falls kein Name vorhanden ist, Name der Organisation oder Abkürzung mit Nummer.
- Name und Anschrift des Eigentümers: dauerhaft innen oder außen am Fahrzeug.
VI. Amtlich anerkannte Kennzeichen: Der Internationale Bootsschein (IBS) und Alternativen
Wie bereits erwähnt, stellen amtlich anerkannte Kennzeichen eine Alternative zu den von den Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern vergebenen amtlichen Kennzeichen dar – allerdings nicht auf Rhein, Mosel und Donau.
A. Ausstellung durch ADAC, DMYV, DSV
Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC), der Deutsche Motoryachtverband (DMYV) und der Deutsche Segler-Verband (DSV) sind von der Bundesregierung ermächtigt, den sogenannten Internationalen Bootsschein (IBS) auszustellen [4 (§5), 6]. Die im IBS vergebene Nummer, kombiniert mit einem Kennbuchstaben der jeweiligen Organisation (A für ADAC, M für DMYV, S für DSV), bildet das amtlich anerkannte Kennzeichen. Der IBS selbst dient als Nachweis über das zugeteilte Kennzeichen und muss an Bord mitgeführt werden [4 (§6), 17]. Die internationale Anerkennung des IBS basiert auf der Resolution Nr. 13 (revidiert) der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE).16
B. Kennzeichen von Landkreisen
Neben den genannten Verbänden sind auch bestimmte Landkreise befugt, amtlich anerkannte Kennzeichen für Kleinfahrzeuge auszustellen.6 Eine detaillierte Liste der zuständigen Landkreise und der von ihnen vergebenen Kennzeichenformate ist über den Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS) einsehbar. Diese Möglichkeit der Registrierung bei lokalen Kreisbehörden bietet eine weitere dezentrale Anlaufstelle, insbesondere in Regionen mit vielen Gewässern, die eventuell nicht in unmittelbarer Nähe zu einem WSA oder einer Geschäftsstelle der Wassersportverbände liegen. Dies spiegelt die föderale Struktur wider, in der regionale Behörden bestimmte Verwaltungsaufgaben übernehmen können.
C. Gültigkeit des IBS
Die Gültigkeit des Internationalen Bootsscheins (IBS) ist ein Punkt, der oft zu Nachfragen führt und differenziert betrachtet werden muss:
- Nationale Gültigkeit (Deutschland): Wird der IBS als Grundlage für ein deutsches amtlich anerkanntes Kennzeichen auf den dafür zulässigen Binnenschifffahrtsstraßen verwendet, so behält das Kennzeichen seine Gültigkeit prinzipiell unbefristet, solange die im IBS registrierten Daten des Bootes und des Eigners unverändert bleiben und korrekt sind.16
- Internationale Gültigkeit: Für die Verwendung im Ausland, beispielsweise als Nachweis des Eigentums gegenüber ausländischen Behörden oder für Zollformalitäten, hat das IBS-Dokument selbst in der Regel eine Gültigkeit von zwei Jahren und muss danach erneuert werden.16 Einige Länder, insbesondere im Mittelmeerraum, legen Wert darauf, dass das vorgelegte IBS-Dokument nicht älter als zwei Jahre ist.19
Diese doppelte Natur der Gültigkeit – national unbegrenzt für die Kennzeichnungsfunktion versus international befristet für die Dokumentenfunktion – kann zu Missverständnissen führen. Es ist wichtig, die Rolle des IBS als heimisches Kennzeichen von seiner Funktion als internationales Bootsdokument zu unterscheiden. Ein für internationale Zwecke abgelaufenes IBS-Dokument macht das deutsche Kennzeichen nicht automatisch ungültig, könnte aber bei Reisen im Ausland zu Problemen führen.
VII. Der Weg zum Kennzeichen: Antragstellung und wichtige Formalitäten
Die Beantragung eines Bootskennzeichens erfordert einige Formalitäten, die je nach Art des Kennzeichens leicht variieren.
A. Antrag für amtliche Kennzeichen (WSA)
- Zuständigkeit: Ein neues amtliches Kennzeichen kann bei jedem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) beantragt werden; eine regionale Bindung besteht für Neuanträge nicht.
- Erforderliche Unterlagen: Üblicherweise werden ein ausgefülltes Antragsformular, ein Eigentumsnachweis für das Boot (z.B. Kaufvertrag, Rechnung), eine Kopie des Personalausweises des Antragstellers und gegebenenfalls die CE-Konformitätserklärung (für Boote, die nach dem 15. Juni 1998 in Verkehr gebracht wurden) benötigt. Für Eigenbauten können zusätzliche Nachweise wie Fotos, Konstruktionszeichnungen oder Gutachten erforderlich sein.
- Verfahren und Kosten: Für die Zuteilung des Kennzeichens wird eine Gebühr erhoben. Der Antragsteller erhält einen „Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen“, der stets an Bord mitzuführen ist.
- Ummeldung (Kennzeichen beibehalten): Soll ein bereits bestehendes amtliches Kennzeichen eines WSA auf einen neuen Eigner umgeschrieben werden (unter Beibehaltung des Kennzeichens), so ist dies nur bei dem WSA möglich, das das Kennzeichen ursprünglich ausgestellt hat. Hierfür ist in der Regel der Original-Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen vorzulegen.
B. Antrag für amtlich anerkannte Kennzeichen (Clubs, Landkreise)
- Zuständigkeit: Anträge für einen Internationalen Bootsschein (IBS) sind an die dafür zuständigen Organisationen (ADAC, DMYV, DSV) zu richten. Der Antragsprozess kann oft online erfolgen.6 Kennzeichen von Landkreisen werden direkt bei der jeweiligen Kreisverwaltung beantragt.6
- Erforderliche Unterlagen: Auch hier sind in der Regel ein Antragsformular, ein Eigentumsnachweis, eine Ausweiskopie und Angaben zum Boot erforderlich.
C. Gültigkeitsdauer und Mitführpflichten
- Gültigkeit: Amtliche Kennzeichen der WSA gelten grundsätzlich unbefristet, solange sich die eingetragenen Daten nicht ändern.6 Amtlich anerkannte Kennzeichen (wie der IBS für die nationale Kennzeichnung) sind ebenfalls gültig, solange die Daten aktuell sind (siehe Abschnitt VI.C).
- Mitführpflicht: Der „Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen“ (bei WSA-Kennzeichen) bzw. der Internationale Bootsschein (bei Club-Kennzeichen) muss während der Fahrt stets an Bord mitgeführt und bei Kontrollen vorgezeigt werden können [4 (§6), 6].
D. Meldepflichten bei Verkauf oder Änderungen
Bootseigner unterliegen bestimmten Meldepflichten, um die Aktualität der Registrierungsdaten sicherzustellen:
- Änderungen: Änderungen des Namens oder der Anschrift des Eigners sowie wesentliche technische Änderungen am Boot (z.B. neuer Motor) müssen der ausstellenden Stelle (WSA, Club oder Landkreis) unverzüglich mitgeteilt werden [4 (§8), 6].
- Verkauf (Veräußerung): Der Verkäufer eines Kleinfahrzeugs ist verpflichtet, den Verkauf der Stelle zu melden, die das Kennzeichen ausgestellt hat, damit die Daten berichtigt werden können. Hierfür ist oft die Vorlage des Original-Ausweises erforderlich. Für den Verkäufer ist diese Anzeige bei WSA-Kennzeichen in der Regel gebührenfrei.6 Es ist wichtig, dass der alte Ausweis nicht einfach dem neuen Eigner übergeben wird, wenn eine offizielle Übertragung des Kennzeichens gewünscht ist oder das Kennzeichen vom Verkäufer abgemeldet werden soll. Eine korrekte Abwicklung verhindert administrative Probleme für beide Parteien.21 Die Verantwortung für die Aktualität der Daten und die korrekte Handhabung der Dokumente, insbesondere bei einem Verkauf, liegt beim Eigner.
- Entfernung ungültiger Kennzeichen: Ein ungültig gewordenes oder abgemeldetes Kennzeichen muss unverzüglich vom Kleinfahrzeug entfernt oder unleserlich gemacht werden [4 (§8 Abs. 3)].
Beispiele unserer Bootsaufkleber:
VIII. Kleine Boote, eigene Regeln: Die Kennzeichnung von Beibooten
Beiboote, oft auch Dingis genannt, unterliegen vereinfachten Kennzeichnungsregeln. Diese pragmatische Handhabung spiegelt ihre Rolle als Hilfsfahrzeuge wider, die meist nicht für lange, eigenständige Fahrten konzipiert sind. Entscheidend ist auch hier die Möglichkeit der Eigentümeridentifizierung.
- Auf den meisten Binnenschifffahrtsstraßen (Geltungsbereich der BinSchStrO) muss ein Beiboot lediglich an der Innen- oder Außenseite ein Kennzeichen tragen, das die Feststellung des Eigentümers gestattet.15 Dies kann beispielsweise der Name des Hauptbootes, der Name des Eigners oder eine andere eindeutige Zuordnung sein.
- Ähnliche Regelungen gelten auch auf Rhein und Mosel: Gemäß § 2.02 Nr. 3 der RheinSchPV bzw. MoselSchPV müssen Beiboote eines Fahrzeugs an der Innen- oder Außenseite nur ein Kennzeichen tragen, das die Feststellung des Eigentümers ermöglicht.9 Für die Donau ist eine vergleichbare Regelung anzunehmen, auch wenn sie in den vorliegenden Informationen nicht explizit für Beiboote detailliert ist.
IX. Zusammenfassung und Checkliste für Skipper
Die korrekte Kennzeichnung Ihres Kleinfahrzeugs ist unerlässlich. Die wichtigsten Punkte sind die generelle Kennzeichnungspflicht, die Unterscheidung zwischen amtlichen und amtlich anerkannten Kennzeichen, die Kenntnis der Ausnahmeregelungen (insbesondere für bestimmte Bootstypen/Motorisierungen und Wassermotorräder) sowie die Beachtung der strengeren Vorschriften auf Rhein, Mosel und Donau.
Die folgende Checkliste hilft Ihnen, die wichtigsten Aspekte zu überprüfen:
- Handelt es sich bei meinem Boot um ein „Kleinfahrzeug“ (Rumpflänge unter 20 m)?
- Fällt mein Boot unter eine der Ausnahmeregelungen von der Kennzeichnungspflicht nach KlFzKV-BinSch (z.B. Motorleistung ≤ 2,21 kW, Segelboot ≤ 5,50 m ohne Motor, reiner Muskelantrieb)?
- Wenn nicht ausgenommen: Benötige ich für meine geplanten Fahrgebiete ein „amtliches Kennzeichen“ oder genügt ein „amtlich anerkanntes Kennzeichen“?
- Achtung Rhein, Mosel, Donau: Hier ist ausschließlich ein amtliches Kennzeichen vom WSA zulässig!
- Achtung Wassermotorrad (Jetski): Hier ist ausschließlich ein amtliches Kennzeichen vom WSA zulässig!
- Ist mein gewähltes Kennzeichen korrekt dimensioniert (mind. 10 cm hoch), farblich kontrastierend und am richtigen Ort (Bug, Heck, Spiegelheck – je nach Vorschrift) angebracht?
- Führe ich den erforderlichen „Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen“ (WSA) oder den Internationalen Bootsschein (IBS) an Bord mit?
- Sind meine bei der Registrierungsstelle hinterlegten Daten (Name, Adresse, Bootsdaten) aktuell?
Zur besseren Übersicht dient die folgende Tabelle, die die wesentlichen Unterschiede der Kennzeichnungsanforderungen auf den Hauptwasserstraßen vergleicht:
Tabelle 2: Vergleich der Kennzeichnungsanforderungen auf Hauptwasserstraßen:
| Wasserstraße | Zulässiger Kennzeichentyp | Anbringungsort | Ersatzkennzeichnung bei Ausnahmen (von der Pflicht zum amtlichen Kennzeichen) |
|---|---|---|---|
| Rhein | Nur amtliches Kennzeichen (WSA) | Beide Vorderseiten (Bug) | Name/Devise + Eigentümeranschrift |
| Mosel | Nur amtliches Kennzeichen (WSA) | Beide Vorderseiten (Bug) | Name/Devise + Eigentümeranschrift |
| Donau (deutscher Abschnitt) | Nur amtliches Kennzeichen (WSA) | Außen (de facto Bug erwartet) | Name/Devise + Eigentümeranschrift |
| Elbe, Weser, sonstige Bundeswasserstraßen | Amtlich ODER amtlich anerkanntes Kennzeichen | Bug oder Heck/Spiegelheck | Gemäß § 2.02 BinSchStrO (Name/Devise + Eigentümer) |
X. Wichtiger Hinweis und Haftungsausschluss
Alle Angaben in diesem Artikel wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung (20. Mai 2025) bekannten Informationen und Vorschriften. Dennoch erfolgen sie ohne Gewähr. Rechtsvorschriften können sich ändern. Für verbindliche und tagesaktuelle Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an die zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter (WSA) oder andere autorisierte Stellen wie ADAC, DMYV oder DSV.
XI. Weiterführende Informationen und nützliche Links
Für detailliertere Informationen und direkten Zugang zu den Rechtsquellen und Antragsformularen empfehlen sich folgende Anlaufstellen:
- ELWIS (Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice): Die zentrale Plattform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bietet umfassende Informationen für die Sportschifffahrt, einschließlich Details zur Kennzeichnung. (extern: https://www.elwis.de/DE/Sportschifffahrt/Binnenbereich/Kennzeichnung-Kleinfahrzeuge/Kennzeichnung-Kleinfahrzeuge-page.html)
- Gesetze im Internet: Ein Service des Bundesministeriums der Justiz, über den Sie direkten Zugriff auf Gesetzestexte haben:
- Kleinfahrzeug-Kennzeichnungsverordnung (KlFzKV-BinSch): (extern: https://www.gesetze-im-internet.de/klfzkv-binsch/BJNR022600995.html)
- Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO): (extern: https://www.gesetze-im-internet.de/binschstro_2012/__2_02.html)
- Automobilclubs und Wassersportverbände: Diese Organisationen bieten Informationen und Antragsmöglichkeiten für den Internationalen Bootsschein (IBS):
- Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC): (extern: https://skipper.adac.de/bootskennzeichen/)
- Deutscher Motoryachtverband (DMYV): (extern: https://www.dmyv.de/int-bootschein/int-bootsschein/uebersicht)
- Deutscher Segler-Verband (DSV): (extern: https://portal.dsv.org/ibs/)
- Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter (WSA): Die lokalen WSA sind die primären Ansprechpartner für amtliche Kennzeichen und spezifische Fragen zu den jeweiligen Wasserstraßen. Die Kontaktdaten finden sich auf den Webseiten der WSV (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes).






















